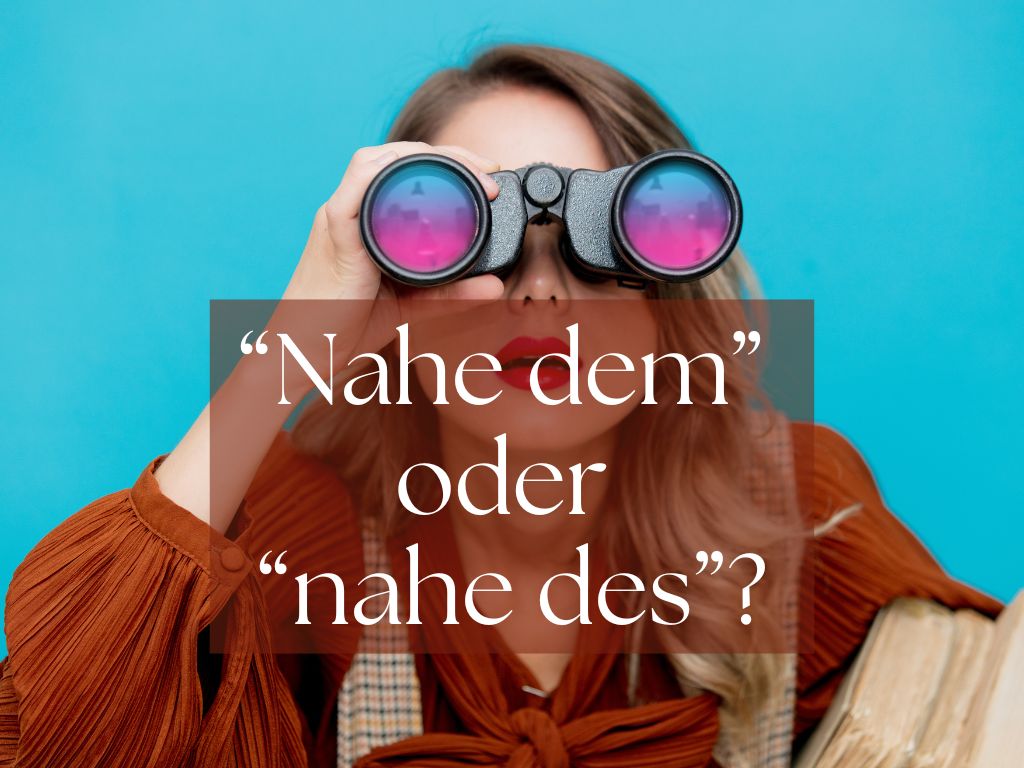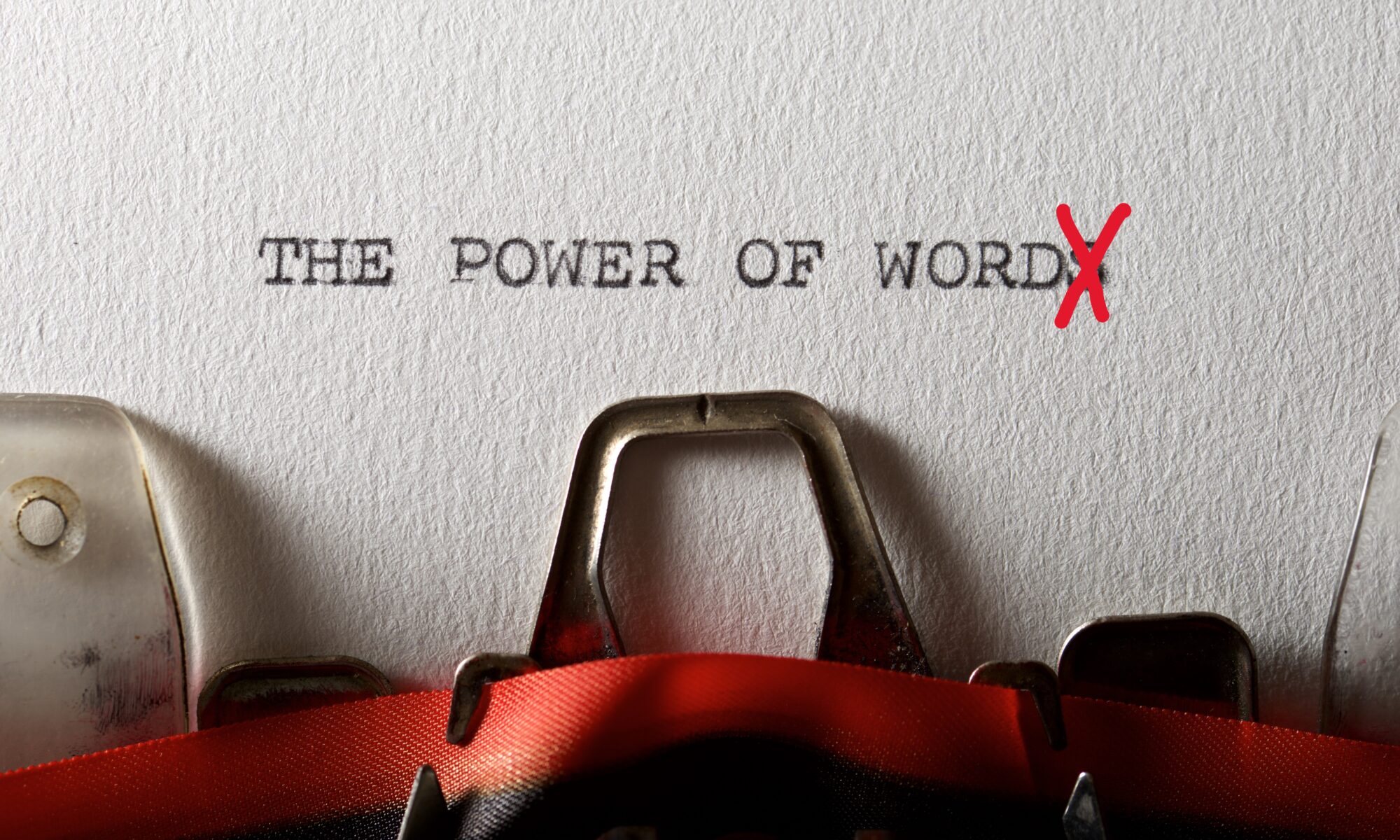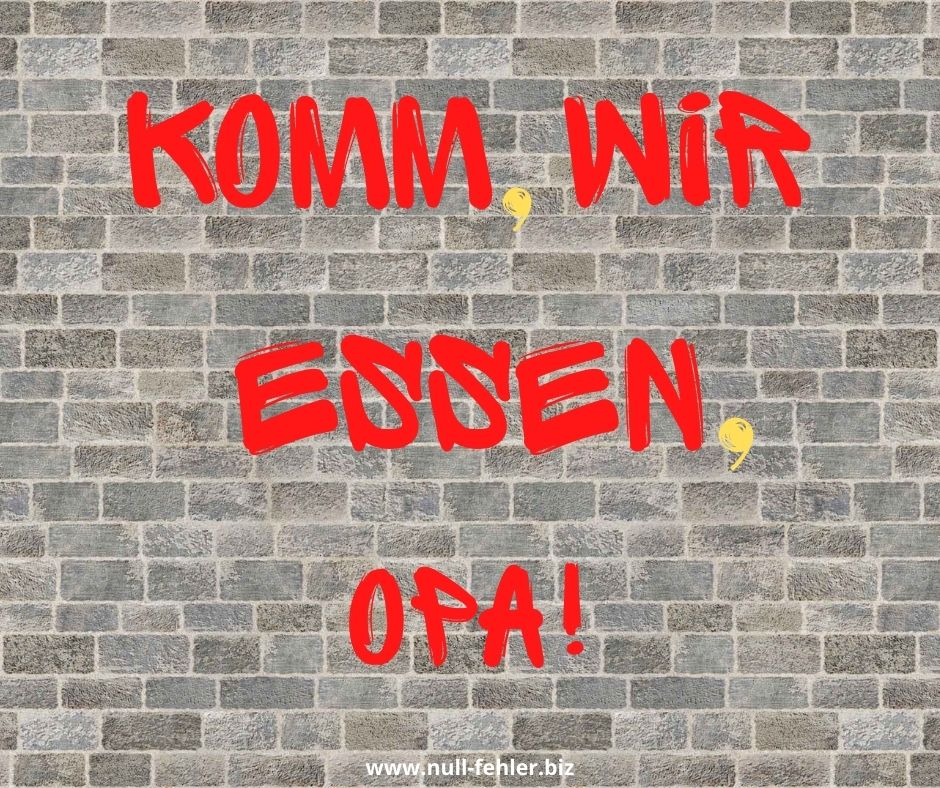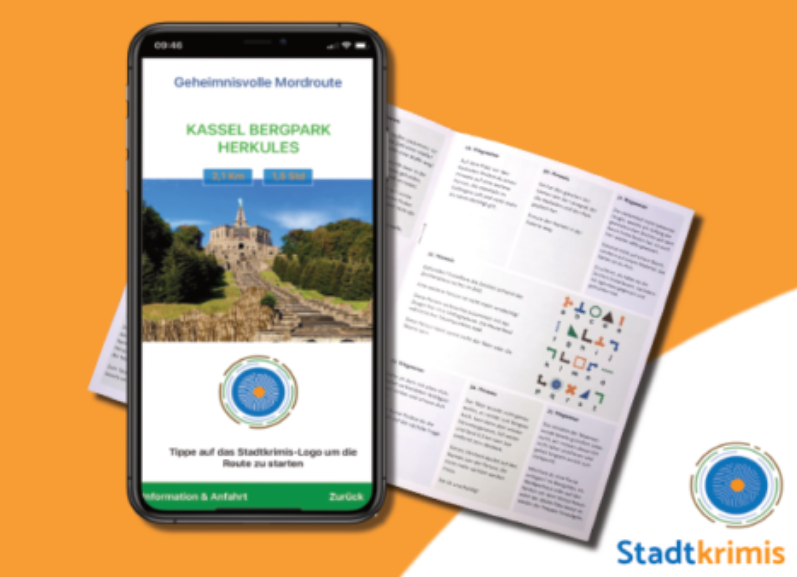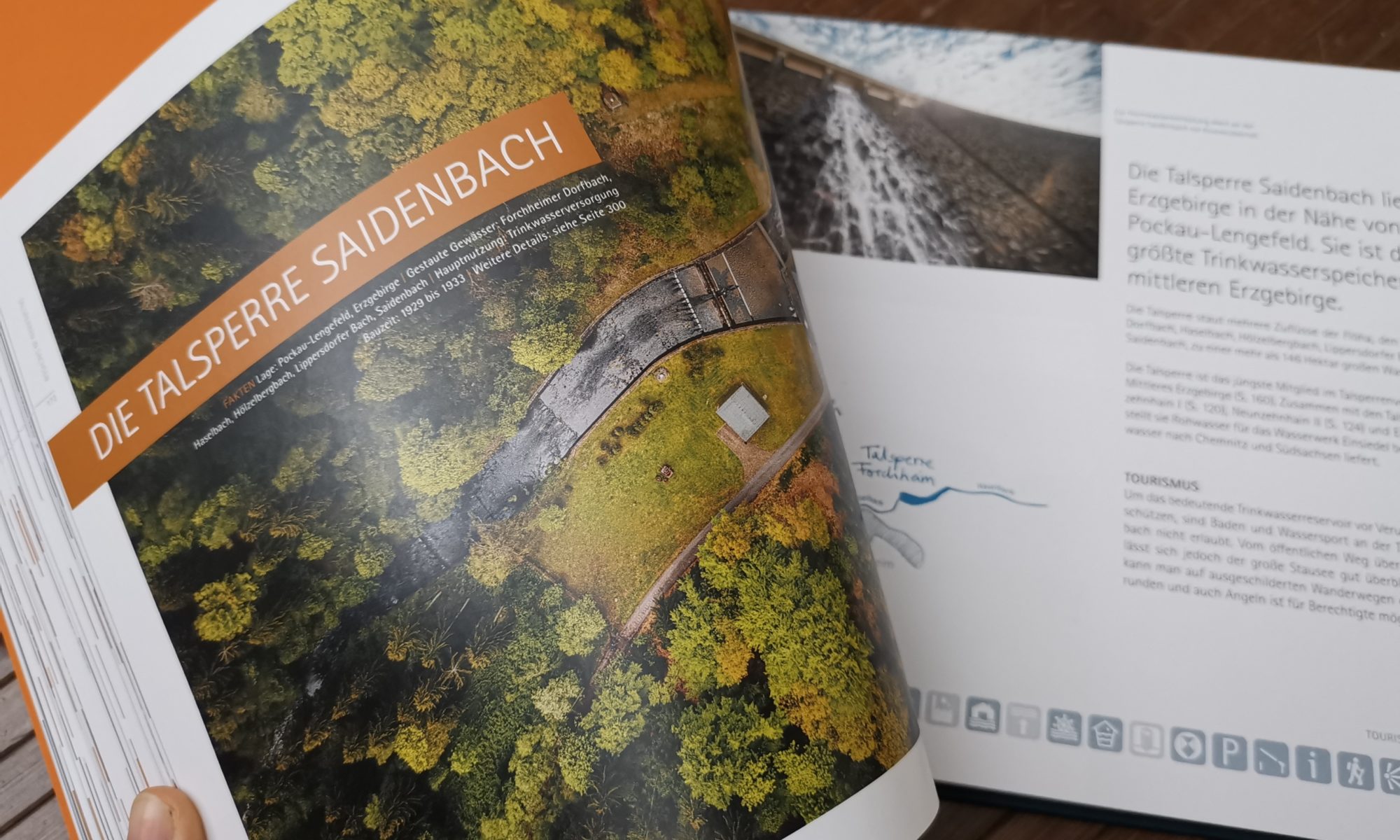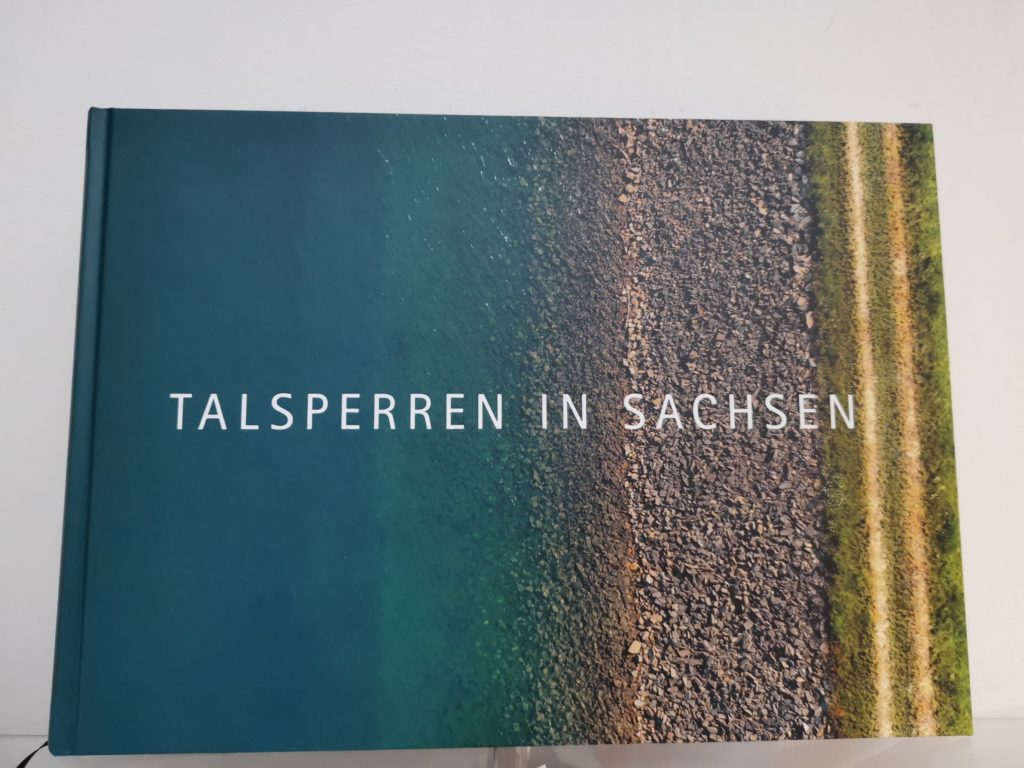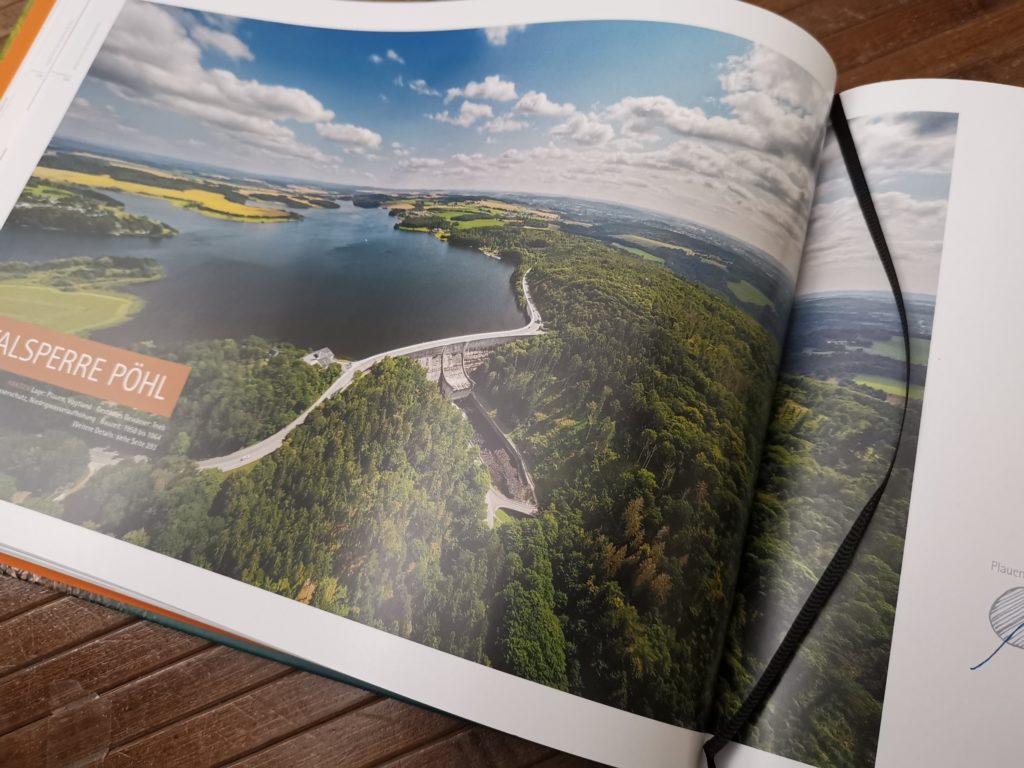Das Textprogramm Word ist sicherlich die bekannteste Software von Microsoft. Und auch, wenn es gute kostenlose Alternativen wie LibreOffice gibt, nutzen die meisten meiner Kunden MS Word für ihre Dokumente – ich also auch.
MS Word ist ein mächtiges Textverarbeitungsprogramm mit vielen nützlichen Funktionen; wer sich ein wenig ausführlicher damit beschäftigt, kann den Arbeitsfluss und die Schreibgeschwindigkeit damit deutlich verbessern. Das Problem: Viele coole und praktische Funktionen in MS Word sind versteckt und erschließen sich nicht intuitiv; man muss schon wissen, wonach man sucht.
Ich stelle daher hier mal meine 3 Lieblingsfunktionen in MS Word vor, die ich am häufigsten benutze, um mir die Arbeit zu erleichtern.
Der Navigationsbereich
In einem längeren Dokument, das durch Überschriften gegliedert ist, lässt es sich superbequem navigieren, wenn man den Navigationsbereich nutzt.
Dafür setzt man in MS Word im Menübereich „Ansicht“ unter dem Reiter „Anzeigen“ ein Häkchen bei „Navigationsbereich“, und schon ploppt dieser links am Bildrand auf. Sofern im geöffneten Dokument Überschriften definiert sind, ist die Orientierung nun richtig einfach – und spätestens jetzt wird auch klar, warum es sinnvoll ist, diese Überschriften in verschiedenen Ebenen zu definieren (also Überschrift 1, 2 und 3).
Will man zu einem bestimmten Kapitel im Word-Dokument springen, muss man nicht endlos scrollen, sondern man klickt einfach auf die gesuchte Überschrift.
Gleichzeitig kann man in dieser Übersicht auch hervorragend nach Wörtern suchen. Oben in der Suchleiste trägt man den Begriff ein und hat dann die Wahl:
- Soll das Ergebnis nur in der Navigationsansicht angezeigt werden? Dann markiert MS Word das jeweilige Kapitel, in dem das gesuchte Wort auftaucht.
- Sollen die gesamten Seiten angezeigt werden? Dann bekommt man eine Miniaturansicht aller Seiten, auf der das gesuchte Wort gelb markiert ist.
- Die Ergebnisse selbst werden als Liste ausgegeben, wobei jeweils ein wenig des Kontextes mit angezeigt wird – allerdings weiß man hier nicht, auf welcher Seite das gesuchte Wort steht.
Der Format-Pinsel
Das Formatieren von Word-Dokumenten ist eine Wissenschaft für sich, und auch nach über 15 Jahren Erfahrung als Lektorin stoße ich hier immer noch auf unüberwindliche Hürden – Microsoft Word ist ein mächtiges Programm mit vielen versteckten Funktionen, das aber oft wenig intuitiv funktioniert.
Eine sehr intuitive Möglichkeit, die Formatierung eines Textbereichs auf einen anderen zu übertragen, ist der Format-Pinsel.
Anstatt händisch die passende Formatvorlage aus dem Formatvorlagen-Katalog auswählen zu müssen, kann man einfach den Pinsel nutzen – sofern es bereits einen Text gibt, der in der gewünschten Formatierung ist.
Draufklicken, den Pinsel auswählen und dann den Pinsel auf den neuen Textbereich setzen – bei einzelnen Wörtern genügt ein Klick, bei Wortgruppen wird der Pinsel über den gesamten Bereich gezogen.
Das ist besonders hilfreich bei mühsam angelegten Nummerierungen oder Gestaltungen, denen man keine neue Formatvorlage zugewiesen hat – sei es, weil man es vergessen hat oder weil man sich die Mühe in einem kurzen Dokument nicht machen wollte.
Tipp: Man kann den Formatvorlagen-Pinsel auch nutzen, um eine Formatierung von einem Word-Dokument in ein anderes zu übertragen! Sie müssen dafür nur beide geöffnet sein.
Tipp 2: Die Formatierungen in Ihrem (vielleicht kopierten) Text sollen aber lieber alle verschwinden, weil Sie ganz neu anfangen wollen? Hier hilft die Tastenkombination Strg+Shift+N, mit der alles auf die Standard-Formatvorlage zurückgesetzt wird (den gewünschten Textbereich dafür vorher markieren!). Der nächste Schritt ist Strg+Leertaste – hiermit verschwinden sämtliche weitere Text-Auszeichnungen wie Fettungen, Kursivierungen etc.
Der Thesaurus
Eigentlich ist es mein Job als Lektorin, Wortwiederholungen oder unpassende Ausdrücke zu korrigieren. Wenn man aber selbst schon merkt, dass ein Ausdruck nicht der optimale ist oder dass man ein Wort bereits zum dritten Mal in einem Absatz verwendet hat, hilft ein Rechtsklick auf das markierte Wort.
Daraufhin öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem man die Option „Synonyme“ wählt – hier wird dann als Shortcut oft schon eine Reihe an Alternativen angeboten. Die Option „Thesaurus“ geht noch mehr in die Tiefe und bietet für jedes Synonym weitere Aufschlüsselungen und Wortbedeutungen an.
Tipp: Auch eine schnelle Übersetzungshilfe ist im Rechtsklick-Menü enthalten – Wörterbuch, adé!
Es gibt viele sehr praktische Funktionen in MS Word …
… aber die Hilfe eines Lektors oder einer Lektorin ist dennoch eine unschätzbare (und in bestimmten Fällen unverzichtbare) Ergänzung. Ich habe schon so viele Tippfehler aus bereits mehrfach elektronisch überprüften Dokumenten getilgt, Logikbrüche entdeckt und verschachtelte Sätze geradegerückt – ich weiß, dass ein geschultes menschliches Auge nicht so bald technisch ersetzt werden kann.